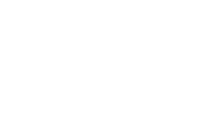Silvio Fischer
 |
|
Wissenschaftliche Ausbildung
| 08/2016 – 04/2022 |
Dissertationsprojekt "Herrschaft und Abwesenheit. Die habsburgischen Landvögte im 14. Jahrhundert." in mittelalterlicher Geschichte, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Professur Prof. Dr. Birgit Studt |
| 10/2013 – 10/2015 |
Masterstudiengang Mittelalter- und Renaissance-Studien Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i. Br. |
| 09/2009 – 02/2013 |
Bachelor of Arts, Geschichte und Medienwissenschaft, Universität Basel |
Abgeschlossene Dissertation: Die Herrschaft Abwesender im Spätmittelalter
Silvio Fischer, Die Herrschaft Abwesender im Spätmittelalter, in: Mittelalter. Interdisziplinäre Forschung und Rezeptionsgeschichte 4 (2021), S. 73–76, DOI: 10.26012/mittelalter-26629.
Beruflicher Werdegang
| seit 04/2023 |
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Rektorat, Abteilung Hochschul- und Wissenschaftskommunikation, Projektleiter Relaunch der zentralen und dezentralen Websites der Universität |
| 07/2022 – 03/2023 |
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Prorektorat für Universitätskultur Koordination der Arbeitsgruppe Leitbild
|
| 11/2016 – 04/2022 |
Geschäftsstelle des SFB 948 Helden – Heroisierungen – Heroismen, |
| 10/2015 – 10/2016 |
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Professur Mittelalterliche Geschichte II, Prof. Dr. Birgit Studt |
Publikationen
Aufsätze
|
Die Herrschaft Abwesender im Spätmittelalter, in: Mittelalter. Interdisziplinäre Forschung und Rezeptionsgeschichte 4 (2021), S. 73-76, DOI:10.26012/mittelalter-26629. |
Rezensionen
|
Wallnöfer, Adelina (2017): Die politische Repräsentation des gemeinen Mannes in Tirol. Die Gerichte und ihre Vertreter auf den Landtagen vor 1500, in: Rheinische Vierteljahresblätter 83 (2019). |
|
Speich, Heinrich (2019): Burgrecht. Von der Einbürgerung zum politischen Bündnis im Spätmittelalter, in: Rheinische Vierteljahresblätter 84 (2020) |
Blogs
|
Zwei Wappenvögel aus dem Umfeld Maximilians 1, auf: Heraldica Nova, 25.01.2016, https://heraldica.hypotheses.org/4103 |
|
Die Quaternionendarstellung in CGM 145 und Konrad Grünenbergs Selbstdarstellung als Stadtbürger, auf Heraldica Nova, 21.12.2015, https://heraldica.hypotheses.org/4017 |
Vorträge
| 01.12.2020 |
Vortrag „Landesherrschaft in Stellvertretung. Die Habsburgischen Landvögte im 14. Jahrhundert“ im Landesgeschichtlichen Kolloquium des Lehrstuhls für Mittelalterliche Geschichte I, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (Prof. Dr. Jürgen Dendorfer) |
| 17.11.2020 |
Vortrag „‘wande mir nit wollten wissen, daz er also schiere in unsir gegen kême.‘ Königliche An- und Abwesenheit im 14. Jahrhundert“ im Colloquium „Neues aus dem Mittelalter“, TU Darmstadt (Prof. Dr. Gerrit Jasper Schenk) |
| 18.09.2020 |
Vortrag „‘wande mir nit wollten wissen,daz er also schiere in unsir gegen kême.‘ Herrscherliche An- und Abwesenheit in der politischen Kommunikation des Spätmittelalters“ im Rahmen des Studientages „Wissen um den König“, Universität Basel, Departement Geschichte (Prof. Dr. Jan Rüdiger, Dr. Ruth Maximiliane Berger) |
| 22.11.2019 |
Vortrag „Ferne Herren – Vögte – Fälschungen? Die Habsburger am Hochrhein im 14. Jahrhundert.“ auf Einladung des Bildungswerkes der Gemeinde Jestetten in der Wittmer-Bibliothek Dettighofen |
| 17.05.2019 |
Vorstellung des Dissertationsprojekt im Rahmen des Kieler Kolloquiums „State of the Art. Theorie und Praxis mediävistischer Forschung. Methoden, Kontroversen, Projekte.“ (Prof. Dr. Andreas Bihrer u. Prof. Dr. Gerald Schwedler) |
| 06.12.2018 |
Vortrag im Rahmen des Mittelbausymposiums „Junge Zürcher Mediävistik“: Herrschaft und Absenz im Spätmittelalter. Die Habsburger in Vorderösterreich im 14. Und 15. Jahrhundert. |
| 20.11.2018 |
Vortrag im Landesgeschichtlichen Kolloquium des Lehrstuhls für mittelalterliche Geschichte I der Universität Freiburg i. Br. (Prof. Dr. Jürgen Dendorfer) |
| 16.11.2018 |
Vorstellung des Dissertationsprojektes im Kolloquium des Konstanzer Arbeitskreises für mittelalterliche Geschichte in Konstanz. |
| 22.–23.05.2018 |
Workshop „Datenbankanwendungen in den Geisteswissenschaften“ mit Andreas Kuczera und Aline Deicke (Als Co-Organisator). |
| 20.04.2018 |
Vortrag vor der AG 8 „Macht, Wissen und Kommunikation in Mittelalter und Früher Neuzeit“ der Graduiertenschule Humanities der Universität Freiburg im Breisgau. |
| 13.–16.03.2018 |
Tagung des Konstanzer Arbeitskreises für mittelalterliche Geschichte. Thema: „Stellvertetung im Mittelalter. Konzepte, Personen und Zeichen im interkulturellen Vergleich“ (als Gast). |
| 08.12.2017 |
Vortrag am Oberseminar des Lehrstuhls für mittelalterliche Geschichte II der Universität Freiburg i. Br. (Prof. Dr. Birgit Studt). |
Lehrveranstaltungen
| 10/2019–04/2020 | Wissenschaftliche Assistenz (Stellvertretung) Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Historisches Seminar Lehrveranstaltung: Proseminar zu Herrschaft und Abwesenheit im Spätmittelalter |
Auszeichnungen und Stipendien
| 04/2022 | Ralf-Dahrendorf Preis der Badischen Zeitung für die Dissertation „Herrschaft und Abwesenheit. Die habsburgischen Landvögte im 14. Jahrhundert.“ Badische Zeitung: Der lange Arm der Habsburger |
| 10/2017 – 03/2021 | Promotionsstipendium der Gerda Henkel Stiftung |
| 03/2015 – 09/2015 | Masterstipendium der Stiftung KStV Bavaria Freiburg |
Letzte Aktualisierung: 23.10.2024